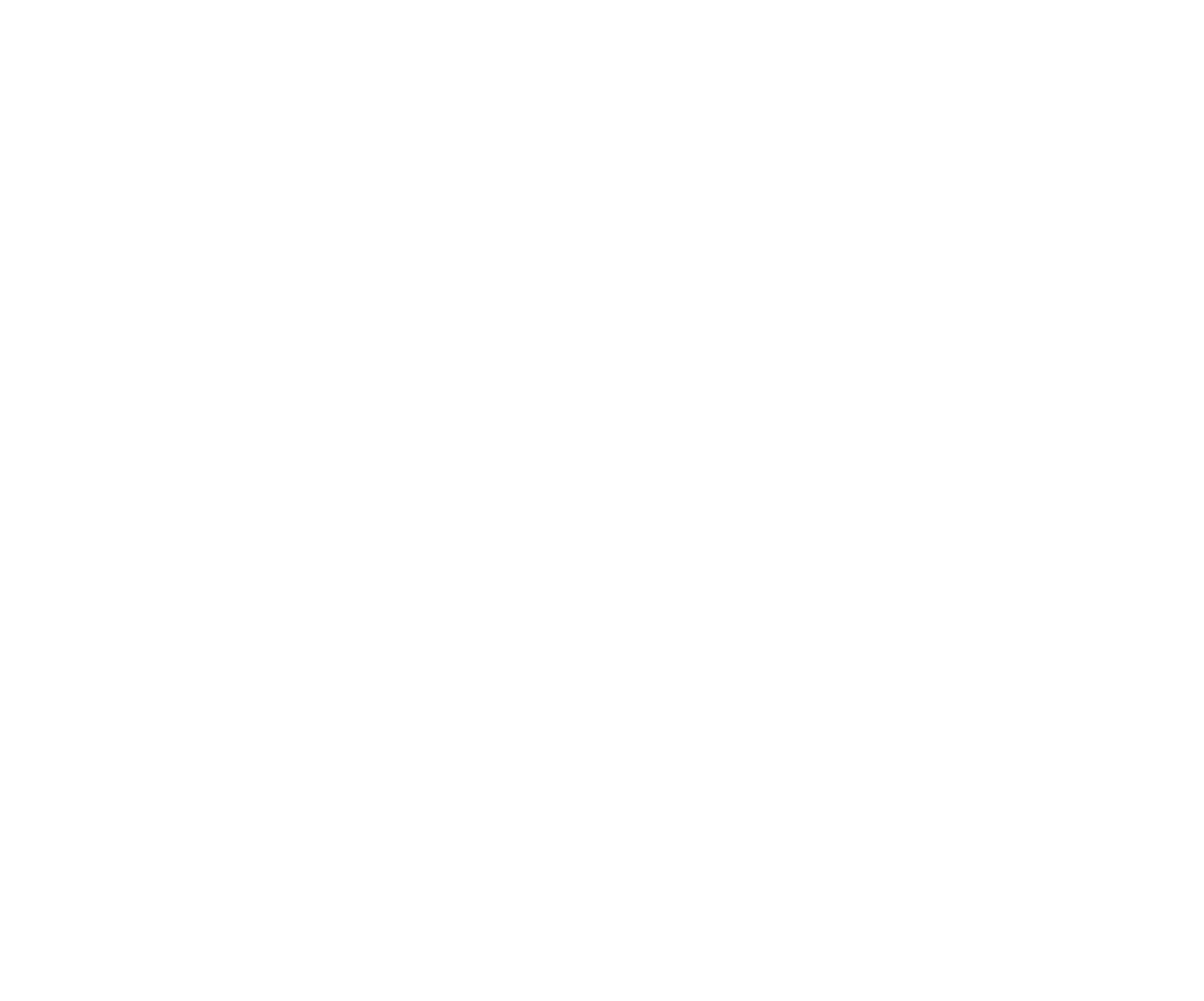Steuerpflicht in Österreich
Allgemein
Für Erwerbstätige sind vor allem die Bestimmungen über Einkommens-, Lohn- und Umsatzsteuer¹ relevant. Umsatzsteuer müssen nur selbstständig Erwerbstätige leisten: Sie wird in der Regel gleichzeitig mit der der Einkommensteuer abgezogen. Einkommensteuer hingegen müssen alle leisten, die ein Einkommen über einer bestimmten Höhe beziehen. Bei unselbstständig Erwerbstätigen wird die Einkommensteuer Lohnsteuer genannt. Diese beiden Arten der Steuer haben viele gemeinsame Bestimmungen. Soweit im Folgenden einzelne Beträge genannt werden beziehen sich diese, wo nicht explizit anders vermerkt auf den Stand 2025.
Die Steuerpflicht beginnt erst ab einer bestimmten Einkommenshöhe. Die Grenze liegt bei einem Einkommen ab €13.308 im Kalenderjahr. Manche Bezüge unterliegen nicht der Einkommensteuer, z.B.: Familienbeihilfe (FBH) oder Kinderbetreuungsgeld (KBG).
Der Allgemeine, der Arbeitnehmer_innen-, der Verkehrs- und der Pensionist_innenabsetzbetrag werden automatisch von Arbeitgeber_in bzw. von der pensionsauszahlenden Stelle berücksichtigt. Das gilt auch für den seit 2019 geltenden „Familienbonus“, wenn die Geltendmachung rechtzeitig gegenüber dem Arbeitgeber_der Arbeitgeberin erfolgt.
Alleinverdiener_innen-, Alleinerzieher_innen-, Unterhaltsabsetzbetrag und der Mehrkindzuschlag müssen extra beantragt werden.
Der Kinderabsetzbetrag wird gemeinsam mit der FBH ausbezahlt und wirkt sich auf die Steuerberechnung nicht unmittelbar aus. Freibeträge werden bereits vor der Steuerberechnung abgezogen.
ÖH-Aufwandsentschädigung (Funktionsgebühr)
Steuer: Das Geld, das du von der ÖH für deine Funktion erhältst ist eine Funktionärsgebühr iSv § 29 Z 4 Einkommenssteuergesetz (EStG). Diese Gebühr muss jedenfalls versteuert werden, wenn du gemeinsam mit anderen Einkünften die maßgebliche Jahresgrenze an Einkommen von € 13.308 überschreitest.
Sozialversicherung: Die Funktionsgebühr unterliegt nicht der Sozialversicherungspflicht, weil es sich nicht um ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit handelt.
Familienbeihilfe und Studienbeihilfe: Da es sich bei der ÖH-Aufwandsentschädigung (Funktionsgebühr) um ein Einkommen im Sinne des EStG handelt, zählt diese als Einkommen und ist daher für die Zuverdienstgrenze der Familienbeihilfe und der Studienbeihilfe relevant.
Waisenpension: Eine feste Einkommensgrenze gibt es beim Bezug der Waisenpension nicht. Wichtig ist jedoch, dass Waisenpension nur zusteht, wenn die Arbeitskraft des Kindes überwiegend durch die Ausbildung beansprucht wird. Die ÖH- Aufwandsentschädigung ist in der Regel unbeachtlich.
Verkehrsabsetzbetrag
Lohnsteuerpflichtigen Arbeitnehmer_innen mit niedrigem Einkommen steht der Verkehrsabsetzbetrag zu. Er wird automatisch von Arbeitgeber_in berücksichtigt, soll die Aufwendungen für die Fahrt zur Arbeit pauschal abgelten und muss nicht extra beantragt werden.
Grenzgänger_innen haben bei der Veranlagung stattdessen Anspruch auf den Grenzgänger_innenabsetzbetrag in derselben Höhe. Besteht ein Anspruch auf einen dieser Absetzbeträge, so kann es bei geringem Einkommen zu einer Negativsteuer kommen.
Arbeitnehmer_innen, die pendeln müssen, können unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich eine Pendler_innenpauschale als Werbungskosten geltend machen.
Pensionist_innenabsetzbetrag
Dieser steht Pensionist_innen bei Jahresbezügen bis € 30.957 Euro zu und beträgt zwischen € 1002 und € 1.476 pro Jahr.
Alleinverdiener_innen und Alleinerzieher_innenabsetzbetrag
Dies Absetzbeträge mindern die Lohnsteuer und betragen pro Jahr mit
- 1 Kind € 601, mit
- 2 Kindern € 813 und
für das 3. und jedes weitere Kind erhöht sich dieser Absetzbetrag um jeweils € 268.
Ist das Einkommen so niedrig, dass sich der Alleinverdiener_innenabsetzbetrag nicht auswirkt, ist die Auszahlung des Absetzbetrags als Negativsteuer möglich. Das gilt allerdings nur, wenn mindestens 1 Kind vorhanden ist, für das Familienbeihilfe (FBH) bezogen wurde.
Alleinverdiener_in ist,
- wer für 1 oder mehrere Kinder mindestens 7 Monate FBH bezogen hat und
- wer mehr als 6 Monate des Jahres, für das die Veranlagung durchgeführt wird, verheiratet ist und von seinem (Ehe)Partner_seiner (Ehe)Partnerin nicht dauernd getrennt lebt.
Die Einkünfte des Partners_der Partnerin dürfen aber bestimmte Grenzen nicht überschreiten. In einer Ehe oder Lebensgemeinschaft mit mindestens 1 Kind darf der Partner_die Partnerin bis zu € 6.937 jährlich beziehen. FBH, Kinderbetreuungsgeld (KBG), Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Unterhalt werden nicht als Einkommen gerechnet, das Wochengeld hingegen schon.
Der Alleinverdiener_innenabsetzbetrag steht immer nur einem Partner_einer Partnerin zu. Wenn beide die Voraussetzungen erfüllen, steht er dem Partner_der Partnerin mit den höheren Einkünften zu. Haben beide keine oder gleich hohe Einkünfte, steht der Absetzbetrag der Frau zu, außer der Mann führt überwiegend den Haushalt.
Zu beantragen ist dieser Absetzbetrag im Vorhinein bei deinem Dienstgeber_deiner Dienstgeberin mit dem Formular E 30. Im Nachhinein kannst du diesen beim Finanzamt mit dem Formular L 1 (über die Arbeitnehmer_innenveranlagung), mit dem Formular E 1 (über die Einkommensteuererklärung) oder mit dem Formular E 5 (bei keinem Erwerbseinkommen) beantragen.
Alleinerzieher_in ist, wer
- nicht mehr als 6 Monate im Kalenderjahr in einer ehelichen oder eheähnlichen Gemeinschaft lebt und
- den Kinderabsetzbetrag für mindestens 1 Kind bezieht.
Kinderabsetzbetrag und Mehrkinderzuschlag
Anspruch auf den Kinderabsetzbetrag haben Familienbeihilfe(FBH)-Bezieher_innen. Er beträgt € 70,90 pro Monat und Kind und wird gemeinsam mit der FBH ausbezahlt.
Der Mehrkindzuschlag beträgt € 24,40 pro Monat für das 3. und jedes weitere Kind. Voraussetzungen sind, dass die FBH für mindestens 3 Kinder bezogen wird und das zu versteuernde Familieneinkommen im Kalenderjahr, das vor dem Jahr liegt, für das der Antrag gestellt wird, die Höhe von € 55.000 nicht überschreitet.
Der Mehrkindzuschlag ist beim Finanzamt für jedes Kalenderjahr gesondert im Rahmen der Arbeitnehmer_innenveranlagung oder der Einkommensteuererklärung zu beantragen. Hast du keine steuerpflichtigen Einkünfte bezogen, kannst du die Auszahlung mit dem Formular E 4 geltend machen.
Unterhaltsabsetzbetrag
Wenn du für ein nicht haushaltszugehöriges Kind nachweislich den gesetzlichen Unterhalt leistest und weder du noch dein_e im selben Haushalt lebender Partner_lebende Partnerin für dieses Kind Familienbeihilfe (FBH) bezieht, besteht Anspruch auf den Unterhaltsabsetzbetrag. Er beträgt monatlich
- € 37 für das 1. Kind,
- € 55 für das 2. Kind und
- jeweils € 73 für das 3. und jedes weitere alimentierte Kind.
Im Unterschied zum Kinderabsetzbetrag wirkt sich der Unterhaltsabsetzbetrag erst im Nachhinein bei der Arbeitnehmer_innenveranlagung oder Einkommensteuererklärung aus.
Familienbonus Plus und Kindermehrbetrag
Durch den Familienbonus Plus wird deine Steuer direkt reduziert, nämlich um bis zu € 2.000 pro Kind und Jahr. Grundsätzlich erhältst du den Familienbonus Plus, solange du für dein Kind Familienbeihilfe (FBH) beziehst. Nach dem 18. Geburtstag des Kindes steht ein reduzierter Familienbonus Plus in der Höhe von € 700 jährlich zu, wenn man für dieses Kind weiterhin FBH bezieht (z.B. während des Studiums).
Geringverdienende Alleinerziehende bzw. Alleinverdienende oder geringverdienende Eltern, die keine oder eine geringe Steuer bezahlen, erhalten einen Kindermehrbetrag in der Höhe von maximal € 700 pro Kind und Jahr.
Absetzbeträge bei niedrigen Einkünften (Negativsteuer)
Bei einem niedrigen Einkommen kann es sein, dass sich die Absetzbeträge kaum oder gar nicht steuermindernd auswirken. Wenn du Alleinverdiener_in (mit mindestens 1 Kind) oder Alleinerzieher_in bist, kann die Negativsteuer jedoch auch höher als der Verkehrsabsetzbetrag von € 487 sein; gleiches gilt für die Pendler_innenpauschale
Die Ermittlung der Negativsteuer erfolgt bei der Arbeitnehmer_innenveranlagung (Formular L 1). Wenn keine steuerpflichtigen Einkünfte im Kalenderjahr bezogen wurden, ist zur Erstattung des Alleinerzieher_innen- bzw. Alleinverdiener_innenabsetzbetrags das Formular E 5 zu verwenden.
Lohnsteuer
Allgemein
Bist du in einem echten Dienstverhältnis, wird die Einkommensteuer „Lohnsteuer“ genannt. Die Lohnsteuer wird von deinem Arbeitgeber_deiner Arbeitgeberin vom Gehalt abgezogen und an das Finanzamt abgeführt.
HINWEIS
Bis zu einem monatlichen Bruttoverdienst von etwa 1.550 Euro musst du gar keine Lohnsteuer für deine laufenden Bezüge bezahlen. Trotzdem solltest du auch dann einen Arbeitnehmer_innenveranlagung (Formular L 1) durchführen lassen, da du unter Umständen „Negativsteuer“ refundiert bekommst.
Solltest du auch noch andere Einkünfte, z.B. aus einem Werkvertrag oder einem freien Dienstvertrag mehr als € 730 jährlich haben, musst du bis zum 30. April des jeweiligen Folgejahres (bei Online-Erklärung bis 30. Juni des Folgejahres) eine Einkommensteuererklärung (Formular E 1 und E 1a) und nicht eine Arbeitnehmer_innenveranlagung durchführen. Das gilt aber nur, wenn dein gesamtes Einkommen € 14.517 übersteigt.
In der Arbeitnehmer_innenveranlagung kannst du außerdem Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen geltend machen. All diese Ausgaben vermindern das steuerpflichtige Einkommen.
Werbungskosten
Werbungskosten sind Ausgaben, die beruflich veranlasst sind und somit im Zusammenhang mit deiner (unselbstständigen) beruflichen Tätigkeit stehen. Bestimmte Werbungskosten werden schon beim Lohnsteuerabzug automatisch berücksichtigt, z.B. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung oder die Arbeiterkammerumlage. Manche Ausgaben können bereits bei der Lohnverrechnung berücksichtigt werden; falls dies nicht möglich ist, kannst du unter anderem folgende Ausgaben in der Arbeitnehmer_ innenveranlagung geltend machen:
- Gewerkschaftsbeiträge,
- Pendler_innenpauschale,
- Pflichtbeiträge an die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) auf Grund einer geringfügigen Beschäftigung und/oder für mitversicherte Angehörige.
HINWEIS
Die Kosten für ein ordentliches Universitätsstudium (Studienbeiträge, Fachliteratur, Fahrtkosten) können ebenfalls als Werbungskosten geltend gemacht werden, wenn das Studium im Zusammenhang mit der ausgeübten oder einer damit verwandten beruflichen Tätigkeit steht oder wenn das Studium eine umfassende Umschulungsmaßnahme dargestellt.
Die Werbungskostenpauschale beträgt € 132 im Jahr und wird unabhängig davon, ob du tatsächlich Werbungskosten hast, bereits bei der Lohnverrechnung berücksichtigt. Folgende Werbungskosten wirken sich nur aus, wenn sie insgesamt mehr als € 132 jährlich betragen: z.B. Arbeitskleidung, Arbeitsmittel, Aus- und Fortbildungskosten, Betriebsratsumlage, Computer samt Zubehör bzw. Internet und soweit diese Kosten beruflich veranlasst sind, Fachliteratur, Fahrtkosten, Kilometergelder, Kosten für beruflich veranlasste Telefonate.
Eine Auflistung sämtlicher Werbungskosten und nähere Details zu den einzelnen Werbungskosten findest du unter: www.oeh.at/47.
Grundsätzlich müssen Werbungskosten durch entsprechende Nachweise (z.B. Rechnungen, Fahrtenbuch) belegt werden können. Du brauchst die Belege zwar nicht der Arbeitnehmer_innenveranlagung beizulegen, musst sie aber 7 Jahre lang aufbewahren, um sie auf Verlangen dem Finanzamt vorlegen zu können.
Einkommenssteuer
Allgemeines
Von „Einkommenssteuer“ ist die Rede, wenn du in einem freien Dienstvertrag stehst oder selbstständig bist. Du musst bis zum 30. April des Folgejahres (bei elektronischer Übermittlung bis 30. Juni des Folgejahres) eine Einkommenssteuererklärung bei deinem Finanzamt (Formular E 1 und E 1a) abgeben, wenn dein Einkommen mehr als € 13.308 im Jahr beträgt. Nach Abgabe der Einkommenssteuererklärung wird mittels Einkommenssteuerbescheid deine Nachzahlung vorgeschrieben. Diese steigt laut Einkommenssteuertarif progressiv an.
Dein Gewinn wird für die Einkommenssteuer herangezogen und berechnet sich durch die Einnahmen abzüglich deiner Betriebs- und Sonderausgaben und deiner außergewöhnlichen Belastungen.
Betriebsausgaben
Auch die Kosten deines Studiums gehören zu den Betriebsausgaben: Handelt es sich um eine Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung, kannst du das von den Steuern absetzen. Betriebsausgaben sind alle Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind, wie z.B.
- Beiträge zur Pflichtversicherung
- Betriebsumlage
- Telefongebühren
- Büromaterial
- Fachliteratur, Aus- und Fortbildungskosten (auch die Kosten für ein ordentliches Universitätsstudium)
- Fahrtkosten
- Berufskleidung, Reinigung, Werkzeuge, Arbeitsmittel
- Studienreisen, Nächtigungsgelder etc.
Beispiel für Ausbildungskosten sind:
- Studienbebühren
- Bücher und Skripten
- Computer und Zubehör
Sonderausgaben
Vom Gewinn werden ebenfalls die Sonderausgaben abgezogen. Sonderausgaben sind private Ausgaben, die steuerlich begünstigt sind. Werden keine Sonderausgaben beantragt, wird automatisch die Sonderausgabenpauschale in Höhe von € 60 Euro berücksichtigt.
Als Sonderausgaben absetzbar sind z.B.
- Kirchenbeiträge bis zu € 600 jährlich
- Steuerberatungskosten
- Spenden an bestimmte Lehr- und Forschungseinrichtungen
- Spenden an bestimmte Behindertensportverbände
- Freiwillige Weiterversicherung in der Pensionsversicherung oder Nachkauf von Schul- oder Studienzeiten
- Verluste aus den Vorjahren
Die meisten Sonderausgaben können (im Rahmen der eigenen Höchstbeträge) auch dann abgesetzt werden, wenn sie für den (Ehe)Partner_die (Ehe)Partnerin bzw. für die Kinder (für die der Kinder- oder Unterhaltsabsetzbetrag zusteht) geleistet werden.
Außergewöhnliche Belastungen
Vom Gewinn werden auch außergewöhnliche Belastungen abgezogen. Darunter werden Ausgaben verstanden, die außergewöhnlich sind, zwangsläufig erwachsen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen, wie z.B. bei Vorliegen einer Behinderung.
Aber auch eine auswärtige Berufsausbildung eines Kindes fällt unter außergewöhnliche Belastung, wenn im Einzugsgebiet des Wohnortes keine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit vorhanden ist.
Bei manchen außergewöhnlichen Belastungen wird ein Selbstbehalt berücksichtigt. Das gilt z.B. für Krankheitskosten, Kurkosten oder Kinderbetreuungskosten bei Alleinerzieher_innen. Die Höhe des Selbstbehalts ist abhängig vom Einkommen und der familiären Situation.
Nach Berechnung des Gewinns und Abzug der Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen steht die Summe fest, die für die Berechnung deiner Steuer herangezogen wird. Die Berechnung der Steuer erfolgt nach dem beschriebenen Steuertarif. Von dem Ergebnis werden dann die jeweils zustehenden Absetzbeträge abgezogen: der Verkehrsabsetzbetrag steht dir bei selbstständigen Einkünften allerdings nicht zu.
Veranlagung beim Finanzamt
Wenn dein Einkommen €13.308 übersteigt, bist du jedenfalls in folgenden Fällen verpflichtet, eine Arbeitnehmer_innenveranlagung bzw. eine Steuererklärung abzugeben:
- wenn neben lohnsteuerpflichtigen Einkünften andere Einkünfte (z.B. aus Werkverträgen) von insgesamt mehr als € 730 vorliegen (Frist: 30. April des Folgejahres; bei elektronischer Erklärung 30. Juni des Folgejahres)
- wenn der Alleinverdiener_innen- oder Alleinerzieher_innenabsetzbetrag oder der erhöhte Pensionist_innenenabsetzbetrag berücksichtigt wurde, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht vorlagen
- wenn im Kalenderjahr zumindest zeitweise gleichzeitig 2 oder mehrere lohnsteuerpflichtige Einkünfte bezogen wurden, die beim Lohnsteuerabzug nicht gemeinsam versteuert wurden
- wenn in der Lohnverrechnung der Familienbonus Plus zu Unrecht oder in zu hohem Ausmaß berücksichtigt wurde
- wenn in der Lohnverrechnung eine zu hohe Pendlerpauschale oder Pendlereuro berücksichtigt wurde
Jedenfalls bist du verpflichtet, eine Arbeitnehmer_innenveranlagung durchzuführen, wenn das Finanzamt dich dazu auffordert.
Sind im Einkommen keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte enthalten (also nur selbstständige Einkünfte oder andere Einkünfte), ist eine Steuererklärung abzugeben, wenn das Einkommen mehr als €13.308 betragen hat. Die Steuererklärung ist in diesem Fall bis 30. April des Folgejahres (bei elektronischer Übermittlung bis 30. Juni des Folgejahres) abzugeben. Außerdem muss auch immer dann eine Steuererklärung abgegeben werden, wenn dich das Finanzamt dazu auffordert.
Eine Arbeitnehmer_innenveranlagung kann auch freiwillig durchgeführt werden. Das ist dann sinnvoll, wenn eine Gutschrift erwartet werden kann, was in folgenden Fällen möglich ist:
- wenn du den Alleinverdiener_innen oder Alleinerzieher_innenabsetzbetrag oder das Pendler_innenpauschale geltend machen willst,
- wenn du während des Jahres unterschiedlich hohe Einkünfte gehabt hast
- wenn du nicht das ganze Jahr über beschäftigt warst (z.B. nur in den Ferien)
- wenn du Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen oder Werbungskosten geltend machen willst,
- wenn du auf Grund der geringen Höhe deines Einkommens Anspruch auf eine Negativsteuer hast.
Für die freiwillige Veranlagung hast du 5 Jahre Zeit. Sollte es zu einer Nachforderung kommen, so kann die freiwillige Veranlagung innerhalb 1 Monats mittels Berufung wieder zurückgezogen werden (das gilt natürlich nicht bei einer Pflichtveranlagung). Die Veranlagung kann auch elektronisch über Finanz-Online durchgeführt werden. Dazu meldest du dich unter: finanzonline.bmf.gv.at/fon an. Nach erfolgter Anmeldung wird die Zugangskennung (Teilnehmer_in ID, Benutzer_in ID und PIN) mittels RSa-Brief zugeschickt.
Mit dieser Zugangskennung kannst du in das Programm Finanz-Online einsteigen und das Veranlagungsformular ausfüllen. Es besteht die Möglichkeit, dass dir der Steuerbescheid elektronisch zugestellt wird. Es ist aber ratsam, sich den Bescheid wie bisher per Post zustellen zu lassen, weil dadurch die Berufungsfrist nicht so leicht übersehen wird.
Weitere Informationen
Auf der Webseite der AK ist auch die Broschüre “Steuertipps für Studierende” abrufbar und bietete weiter Informationen. (Stand: Jänner 2025)
¹Studieren, Arbeiten, Sozialversicherung-Broschüre https://www.oeh.ac.at/wp-content/uploads/shop/Studieren_Arbeiten_Sozialversicherung_web.pdf (abgerufen am 15.06.2025)
²Steuertarif und Steuerabsetzbeträge https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/arbeitnehmerveranlagung/steuertarif-steuerabsetzbetraege/steuertarif-steuerabsetzbetraege.html#:~:text=F%C3%BCr%20das%20Jahr%202025%20wurde,um%203%2C8333%20Prozent%20angehoben.(abgerufen am 15.06.2025)